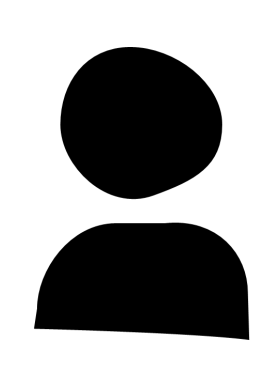Soziales Mitspracherecht und Schutz vor Gewalt
Projekt abgeschlossen
Laufzeit: 01.12.2023 - 31.05.2025
Projekttitel: Stärkung von Frauenrechten und Geschlechtergerechtigkeit durch konfliktsensible Ansätze
Finanziert durch: BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit) und GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
Projektregionen: Michika, Guyuk (administrative Regionen in Nigeria)
Partnerorganisation: CRUDAN & CEPAD
Themen: Geschlechtergerechtigkeit
Die Situation vor Ort
In Nigeria herrscht ein patriarchales Gesellschaftssystem, in dem Frauen und Mädchen aufgrund religiöser und kultureller Normen häufig Unterdrückung erfahren. Hinzu kommt ein jahrzehntelanges politisches und gesellschaftliches Machtungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Viele Paare im Land bevorzugen es beispielsweise, männliche Kinder zu bekommen. Dieses Muster ist im Norden des Landes besonders ausgeprägt.
Sogar die Gesetzgebung des Landes toleriert Gewalt an Frauen: Beispielsweise gibt es ein Gesetz, das Gewalt als legitimes Mittel in Ehekonflikten anerkennt, ebenso wie die Vermittlung minderjähriger Ehepartnerinnen. Die ungleiche Behandlung von Männern und Frauen spiegelt sich auch in der Rollenverteilung gesellschaftlich verantwortungsvoller Aufgaben wider. Frauen werden weitgehend von Führungspositionen ausgeschlossen, erleben überproportionale geschlechtsbasierte Gewalt und haben nur eingeschränkt Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheitsversorgung.
Warum die Arbeit in unseren Projektregionen besonders wichtig ist
In den Regionen Michika und Guyuk im Norden des Landes herrschen darüber hinaus seit vielen Jahren bewaffnete Konflikte. Dies hat gesellschaftliche Probleme wie Armut, Analphabetismus und unzureichende Gesundheitsversorgung weiter verschärft. Zudem wurden in diesen Regionen über einen längeren Zeitraum besonders ausgeprägte Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt sowie systematische Benachteiligung von Frauen festgestellt.
Das äußert sich beispielsweise in der gesellschaftlichen Rolle von Frauen, die meist eine Dreifachbelastung von landwirtschaftlicher Arbeit, Kindererziehung sowie Haushaltsaufgaben übernehmen müssen, ohne aber bei Arbeitsaufteilung oder wirtschaftlichen Entscheidungen mitbestimmen zu dürfen.
Unser Ziel
Um die Rechte von Frauen und Mädchen zu fördern, haben wir uns im Rahmen des Projekts drei zentrale Ziele gesetzt:
- Den Abbau geschlechtsspezifischer Diskriminierung.
- Die Transformation patriarchaler Strukturen.
- Die Einbindung marginalisierter Gruppen (nicht nur Frauen, sondern auch Menschen mit Behinderung oder Rückkehrer*innen) in politische Entscheidungsprozesse.
Dafür war eine unserer wichtigsten Strategien die gendertransformative Gemeindearbeit sowie Dialogformate mit lokalen Autoritäten. Dafür haben wir 13 Versammlungsorte für die jeweiligen Gemeinschaften eingerichtet, in denen es Raum für Diskussion, Training und Austausch gab.
Dabei wurden auch Gender-Expert*innen ausgebildet, sogenannte Community Gender Champions (CGCs), die in wichtigen Entscheidungsprozessen die Perspektive von Frauen einbringen konnten. Das hat die Rechte, Teilhabe und Vertretung von Frauen merklich verbessert.

Plenum einer Frauengruppe in Michika. Durch das Projekt zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, das Oxfam in Zusammenarbeit mit seinen Partnern durchgeführt hat, sind mehr Frauen in politische Entscheidungspositionen gekommen.
So haben wir unser Ziel erreicht
Während des Projektzeitraums haben wir mehr als 2.800 Menschen (davon mehr als 1.600 Frauen) auf direkte Weise und mehr als 25.000 Menschen indirekt erreicht. Das zeigt, welchen enormen gesellschaftlichen Effekt unser Programm hatte.
Unsere Ziele (Abbau geschlechtsspezifischer Diskriminierung, Transformation patriarchaler Strukturen und die Einbindung marginalisierter Gruppen in politische Entscheidungsprozesse) konnten wir durch diese Ergebnisse erreichen:
-
In den Projektregionen haben fünf traditionelle Autoritäten sogenannte „Safe Spaces“ für Frauen und Mädchen eingerichtet, um Fälle von Gewalt zu melden. Im Projektzeitraum zeigte sich eine deutliche Reduktion häuslicher sowie geschlechtsspezifischer Gewalt. Die Vorfälle sanken von 10-15 zu 1-4 Fällen pro Woche.
-
25 Fälle von Landaufteilung wurden zugunsten von Frauen gelöst, sodass sie jetzt Zugang zu eigenem Anbaugebiet haben. 227 Frauen haben Angebote zur Verbesserung von Führungsqualitäten an- und einige, im Anschluss, auch Führungsrollen eingenommen. Fünf Frauen wurden in Entscheidungskomitees der Gemeinden einbezogen.
-
Beamte aus unterschiedlichen Ministerien erhielten Beratungen zu geschlechtergerechter Verwaltung. Die erhöhte Sensibilität für das Thema führte dazu, dass Finanzbeamte auch Programme zu Geschlechtergerechtigkeit in die Budgetplanung der lokalen Bezirke aufnahmen.
-
Es wurden in den Projektregionen 256 Radiofolgen zu benachteiligenden Geschlechtsstereotypen ausgestrahlt, die einen öffentlichen Dialog zum Thema gefördert haben. Das Thema wurde auch in Nachrichten, Social Media oder Videodokumentationen verhandelt.
-
Geschlechtergerechtere Care-Arbeit (darunter Pflege und Betreuung) sowie kollaborative, inklusivere Planung und Entscheidungsfindung in den Gemeinschaften mithilfe zweier Programme zu Care-Arbeit und inklusiver Verwaltung.
-
Geschlechtergerechtigkeit wurde von bestehenden Strukturen und Autoritären dauerhaft als Thema aufgegriffen und dadurch an die Bedürfnisse und Realitäten der Menschen vor Ort ausgerichtet.
Der Erfolg unseres Projekts beruhte vor allem darauf, dass alle gesellschaftlichen Ebenen in den Prozess eingebunden wurden, darunter insbesondere religiöse und traditionelle Führungspersonen. Dadurch konnten wir einen Dreiklang aus strukturellen Reformen, wirtschaftlicher Stärkung von Frauen und gesellschaftlichem Bewusstseinswandel herbeiführen.
Für unsere Projekte zu Geschlechtergerechtigkeit und unsere Vision von einer Welt ohne Armut sind wir auf Spenden angewiesen. Unterstützen Sie unsere Arbeit jetzt!